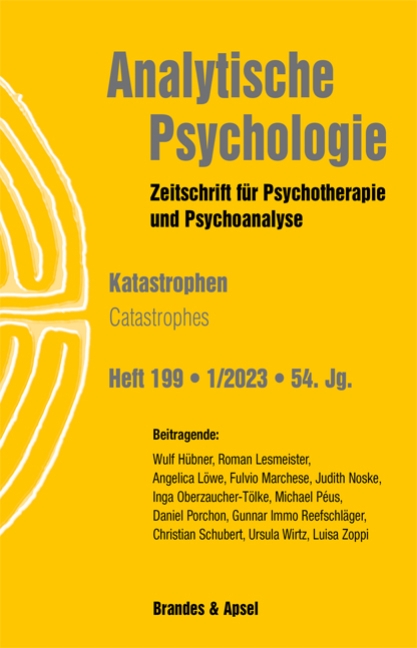Analytische Psychologie
Zeitschrift für Psychotherapie und Psychoanalyse
Katastrophen
Catastrophes
Inhalt
Inga Oberzaucher-Tölke
Editorial
Beitrag 1
Angelica Löwe und Judith Noske
»Böhmen liegt am Meer«: Ortlosigkeit und der Wunsch, zugrunde zu gehen
Nachdenken über die Verzweiflung von Patientinnen und die Arbeit der Analytikerin
Beitrag 2
Wulf Hübner
Die Weitergabe der Traumata an die nächste Generation geschieht durch Beschämung.
Beitrag 3
Michael Péus
Prometheus – Epimetheus – Pandora
Das Katastrophische bei C. G. Jung
Essay
Roman Lesmeister
Über Ruinen
Beitrag 4
David Porchon
Gewalt und Verdrängung im Anthropozän
Denkbild
Michael Péus
Maskentragen
Beitrag 5
Luisa Zoppi
»Blade Runner« und die Welt des echten Lebens
Analytisches Setting und Übertragungsdynamik
Beitrag 6
Psychosomatisches Forum
Christian Schubert
»Der Tod hält mich wach«
Die Symbolik des Joseph Beuys als Ideengeber für eine neue Medizin
Jungianische Identitäten
Ursula Wirtz
»Ein am Nein gereiftes Ja«
Beitrag 7
Fulvio Marchese u. a.
Psychose, Symbol, Affektivität 2
Eine alternative Sichtweise auf die Behandlung der psychotischen Störung
Beitrag 8
Gunnar Immo Reefschläger
Strukturelle Aspekte synchronistischer Momente in der Psychotherapie
Erkenntnisse einer empirischen Studie zum Synchronizitätsphänomen in Psychotherapie und Psychoanalyse
Buchbesprechungen
Förderpreis der Zeitschrift Analytische Psychologie
Vorschau
Richtlinien für Autorinnen und Autoren
»Böhmen liegt am Meer«:
Ortlosigkeit und der Wunsch, zugrunde zu gehen Nachdenken über die Verzweiflung von Patientinnen und die Arbeit der Analytikerin
Zusammenfassung: Die innerer Ortlosigkeit entspringende Verzweiflung scheint um einen unsichtbaren Punkt zu kreisen, in dem das Nichts zuhause ist und die ein Erleben zu repräsentieren scheint, wo ein Noch-Nicht an ein Nicht-Mehr direkt angrenzt, ein Erleben, das keinen Raum freilässt, in dem ein Ich überleben könnte. Anhand eines späten Gedichts von Ingeborg Bachmann (»Böhmen liegt am Meer«) und des Nachrufs auf eine junge Patientin reflektieren wir über die Öffnung eines inneren Raums im Analytiker, von wo her auf den Verzweiflungsruf von Patienten Antwort kommt als Containment dieser dem Nichts korrespondierenden Ortlosigkeit. »Böhmen liegt am Meer« durchquert einen unendlichen Raum zwischen Auslöschung und Formgebung. Hier suchen wir von unterschiedlichen Positionierungen aus nach Resonanzen.
Angelica Löwe entdeckt in der Metaphorik des Gedichts, dass Verzweiflung und Sicherheit koexistieren können. Dies ist möglich durch die Transposition existentieller Verlorenheit in einen Sprachraum hinein, in dem das in Frage stehende Ich ein »Vagant«, überall und nirgends sein kann.
Judith Noske reflektiert die therapeutische Begleitung einer suizidalen Patientin als Prozess der Nachträglichkeit und des Erinnerns. Zwischen der Sehnsucht nach Leben und deren Enttäuschung, der Angst vor und dem Wunsch nach dem Tod hatte die junge Frau ein Gegenüber gesucht, das sie »aushalten« sollte. Was passiert in uns, wenn der Sprachraum so reduziert ist, dass daraus keine Symbolisierung erwachsen kann? Die Bezeugung der Vergeblichkeit gehört trotz tiefster Sehnsüchte zu den Paradoxien, in die uns die Arbeit mit frühverletzten suizidalen Menschen hereinholt. Das Sein und das Nicht–Sein zu denken und zuzulassen, im Anderen und in uns wird hier zur Herausforderung. Der Austausch von inneren Bildern, die die Patientin im Team hinterlassen hatte, ermöglichte allen Beteiligten eine Trauerarbeit, in der neben der Vergeblichkeit eine Verbundenheit erfahrbar wurde, die ihr Leben über den Tod hinaus wahrnehmbar werden ließ.
Schlüsselwörter: Ortlosigkeit, Verzweiflung, Ingeborg Bachmann, Gedicht, Vagant, Rhythmus, Suizid, Trauer, Arbeit der Analytikerin
Wulf Hübner
Die Weitergabe der Traumata an die nächste Generation geschieht durch Beschämung.
Zusammenfassung: Freud hat an seiner ursprünglichen Traumatheorie zeitlebens festgehalten. Der Autor knüpft daran an und folgt Freud: schon sehr früh erwehre sich das Individuum einer peinlich empfundenen Zumutung der Außenwelt - einer traumatischen Beschämung - durch Verleugnung. Der Autor skizziert die Metapsychologie der Scham: Verleugnung, Spaltung von Fühlen und Denken, Umwandlung von Scham in Schuld durch eine »Selbstübersetzung«, Errichtung der Introjekte, Integrationskonflikt. Er beschreibt die sich daraus ergebenden klinischen und behandlungstechnischen Probleme und veranschaulicht sie durch Vignetten aus der Literatur und am Schluss durch eigene Behandlungsbeispiele.
Schlüsselwörter: Verleugnung, Spaltung, Scham, Introjekte
Michael Péus
Prometheus – Epimetheus – Pandora
Das Katastrophische bei C. G. Jung
Zusammenfassung: C. G. Jungs Denken war zeitlebens geprägt von der Sorge um das Schicksal der individuellen Seele, um die Zukunft von Menschheit und Menschlichkeit. Die schließlich von unintegrierten sowie auch unintegrierbaren Sphären des Psychischen selbst ausgehenden Gefahren besitzen für ihn alarmierendes katastrophisches Potential. Der Mythos von Prometheus, Epimetheus und Pandora lässt auf eine das Wesen des Katastrophischen prägende archetypische Dynamik stoßen, deren Kern als sich immerwährend neu ereignender Verlust des Vertrauens in Denken und Vernunft bestimmbar ist. Jung, von dieser Dynamik persönlich zutiefst affiziert, rang um die Möglichkeit des »Logos« und des »Dialogos«, von Übersetzbarkeit und Übertragbarkeit durch seinen »Weg der Mitte«, durch De-Identifikation, Selbstreflexion und konstruktives Zweifeln.
Schlüsselwörter: Katastrophe, Prometheus, Vernunft, Bewusstseinsprozess, Subjekt
David Porchon
Gewalt und Verdrängung im Anthropozän
Zusammenfassung: Dieser Artikel ist eine Diskussion über die psychischen Mechanismen des Handelns im Anthropozän. Er untersucht insbesondere den Mechanismus der Selbsttranszendenz und die Verdrängung von Destruktivität. Unter Rückgriff auf einige Elemente der Erdsystemwissenschaften schlägt er somit vor, die Umweltkatastrophe durch das Prisma der menschlichen Gewalt zu untersuchen.
Schlüsselwörter: Anthropozän, Gewalt, Verdrängung, Selbsttranszendenz
Luisa Zoppi
»Blade Runner« und die Welt des echten Lebens
Analytisches Setting und Übertragungsdynamik
Zusammenfassung: Der Begriff »Skype« wird in diesem Beitrag stellvertretend für die große Palette an technologie- und videogestützten Psychotherapieformen verwendet, zu denen wir auch die Analyse zählen können. Zunächst gehe ich auf meine anfänglich starken Zweifel hinsichtlich der Verwendung von Skype in der Analyse ein und versuche, meine Überlegungen zu diesem Thema zu erläutern, indem ich den Diskurs über die analytische Begegnung in die aktuelle Betrachtungsweise komplexer Systeme – wie etwa bei Cambray (2006) – einordne. Ich werde dabei neben Ogden (1994) und Crowther & Schmidt (2015) auch einige Werke von Jung (1929; 1935; 1944; 1948) zur Komplexität des Übertragungsfeldes heranziehen und zwei klinische Vignetten präsentieren. Eine dieser Vignetten stammt aus einer Skype-Analyse und zeigt, dass sich ein analytisches Feld trotz der Zweifel der Analytikerin am Einsatz eines technologischen Mediums bilden kann.
Schlüsselwörter: Analytisches Feld; Analytisches Setting; Pandemie; Onlinetherapie; Gegenübertragung
Psychosomatisches Forum
Christian Schubert
»Der Tod hält mich wach«
Die Symbolik des Joseph Beuys als Ideengeber für eine neue Medizin
Zusammenfassung: Das Leib-Seele-Problem gehört zu den wesentlichen erkenntnistheoretischen Problemen der Medizin. Bis heute wurden zu seiner empirischen Untersuchung reduktionistisch-mechanistische Ansätze eingesetzt (z. B. in den Neurowissenschaften), die der Komplexität der Fragestellung nicht Rechnung tragen können. Methode: In dieser Studie wurde eine biosemiotisch-systemisch basierte Komplexitätsanalyse von Leben und Kunst von Joseph Beuys durchgeführt. Dazu wurden die folgenden Mittel angewendet: Tiefenhermeneutik, induktive Kategorienbildung und Identifikation von selbstähnlichen (fraktalen) biopsychosozialen Musterbildungen. Ergebnisse: Es ließen sich in Beuys’ Lebens- und Kunstäußerungen Selbstähnlichkeiten (Fraktale) identifizieren, die mit einem möglichen Erstickungstrauma assoziiert und bis in biologische Krankheitsprozesse nachzuverfolgen waren. Schlussfolgerungen: Wenn die hier gezeigten Ergebnisse an weiteren Fällen replizierbar sind, könnte in Zukunft eine auf der Fraktalgeometrie basierende, biopsychosozial erweiterte medizinische Diagnostik, Therapie und Prävention möglich sein.
Schlüsselwörter: Joseph Beuys, Leib-Seele-Problem, biopsychosozial, Fraktal, Trauma
Fulvio Marchese, Barbara Bonanno, Daniele Borinato, Sofia Burgio, David Mangiapane, Marco Matranga, Epifania Saputo und Daniele La Barbera
Psychose, Symbol, Affektivität 2
Eine alternative Sichtweise auf die Behandlung der psychotischen Störung
Zusammenfassung: Dies ist der zweite von zwei Beiträgen über unsere Studie zu einem integrativen Behandlungsansatz für psychotische Störungen, welche an der Abteilung für Psychiatrie der Poliklinik der Universität Palermo über einen Zeitraum von ungefähr 15 Jahren durchgeführt wurde. In diesem Teil konzentrieren wir uns auf die klinischen Aspekte der Studie. Ziel dieser Studie war es, die bestmögliche Behandlungsmethode zu finden und die Prognose für betroffene Patienten zu verbessern. Wir haben die Wirksamkeit einer Reihe an psychotherapeutischen Behandlungsmethoden (darunter die kognitive Verhaltenstherapie, systemische und psychodynamische Psychotherapie, Gruppentherapie und andere) sowie psychopharmazeutischen, psychiatrischen Rehabilitations- und psychopädagogischen Behandlungsmöglichkeiten untersucht und dabei einen hermeneutischen anstelle eines systematischen Ansatzes verfolgt. Wir kamen im Zuge dieser Studie zu der Schlussfolgerung, dass alle psychotischen Funktionen mit einem psychischen Kernproblem beginnen, das mit der emotionalen Entwicklung zusammenhängt. Wir beschreiben in diesem Beitrag, wie sich die zentralen Symptome akuter psychotischer Manifestationen (Wahnvorstellungen und Trugwahrnehmungen) eine verschlüsselte psychologische Bedeutung zunutze machen, die anhand der symbolischen Sprache des Patienten entschlüsselt werden kann. Diese Sprache ist ein zentrales Element sowohl in der Diagnose als auch in der Wahl der Behandlungsmethode. Der Beitrag beschreibt, wie wir unser Verständnis der Psychose von einer Erkrankung des Gehirns zu einem Neuordnungsprozess der psychischen Funktionen revidiert haben, und präsentiert die wichtigsten Ergebnisse unserer Studie.
Schlüsselwörter: affektive Neurowissenschaft, Affektivität, Analytische Psychologie, C. G. Jung, J. W. Perry, Ausbruch der Psychose, Behandlung von Psychosen
Gunnar Immo Reefschläger
Strukturelle Aspekte synchronistischer Momente in der Psychotherapie
Erkenntnisse einer empirischen Studie zum Synchronizitätsphänomen in Psychotherapie und Psychoanalyse
Zusammenfassung: Synchronizität bezeichnet eine sinnhafte Koinzidenz von Ereignissen, welche uns aus den Behandlungen mit PatientInnen zwar bekannt, doch bisher wissenschaftlich wenig untersucht worden ist. Der folgende Beitrag stellt eine erste empirische Untersuchung vor, bei der eine wissenschaftliche Annäherung an Synchronizitätsphänomene im Zusammenhang mit Psychotherapien und Psychoanalysen unternommen wurde. Anhand einer Reihe klinischer Fälle (n=46) konnte zum ersten Mal empirisch nachgewiesen werden, dass Synchronizitätsphänomene einen positiven Einfluss auf Therapien haben. Voraussetzung hierfür ist das Aufgreifen und Ansprechen des Ereignisses durch den Therapeuten, wodurch das Synchronizitätsphänomen therapeutisch nutzbar wird.
Schlüsselwörter: Synchronizität; Psychotherapien; Empirisch; Therapeut; Voraussetzung