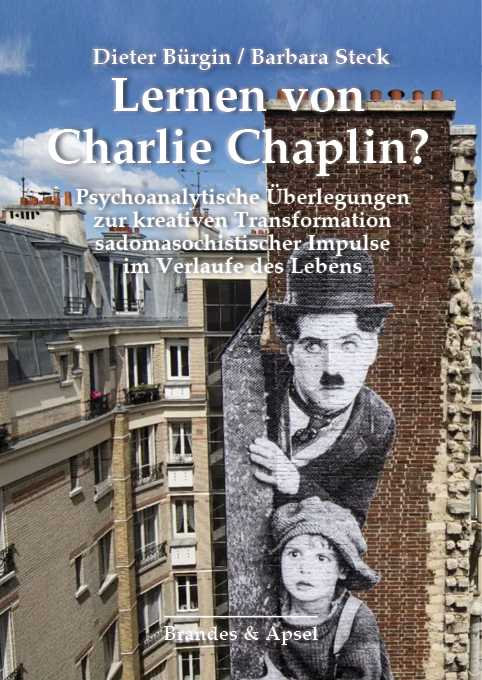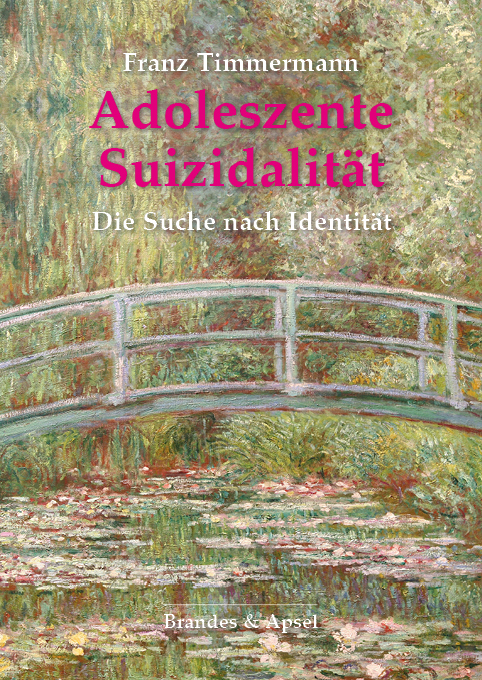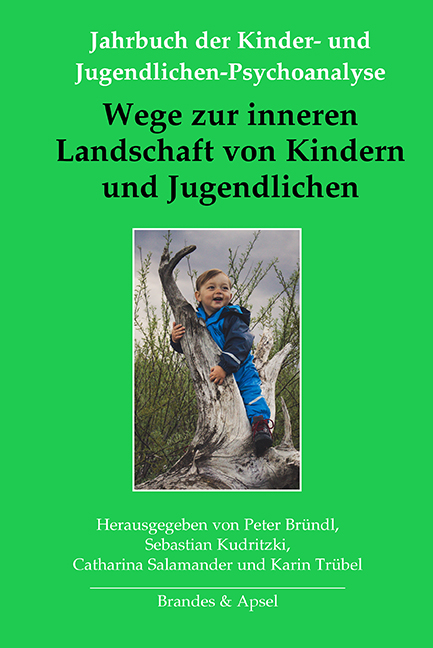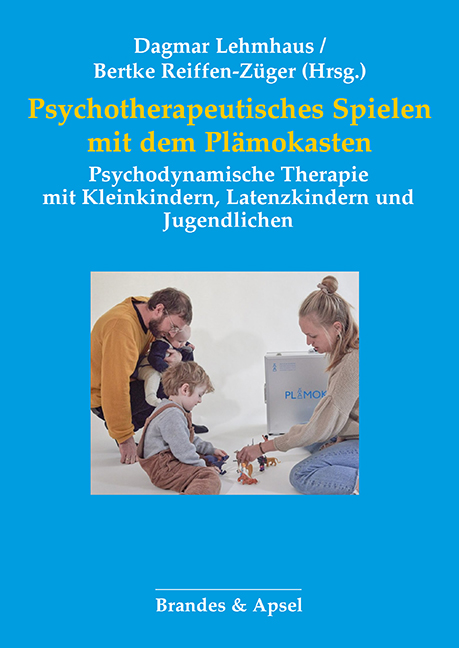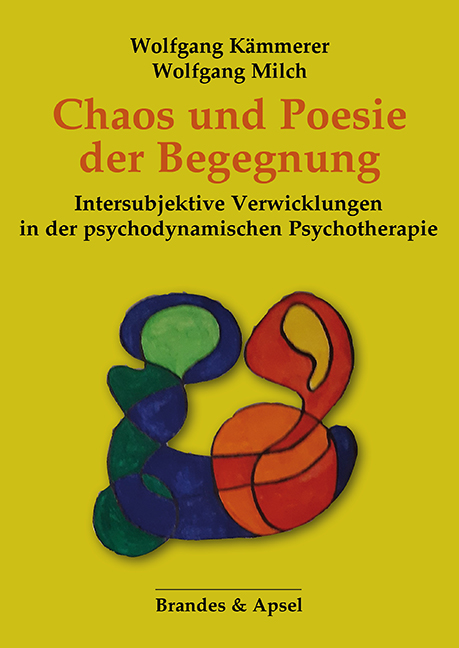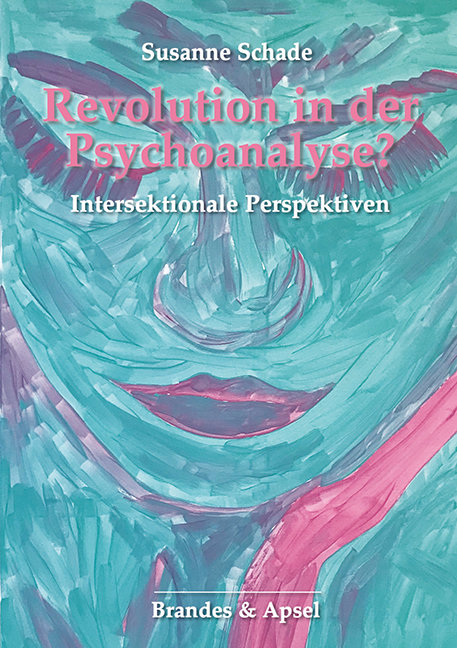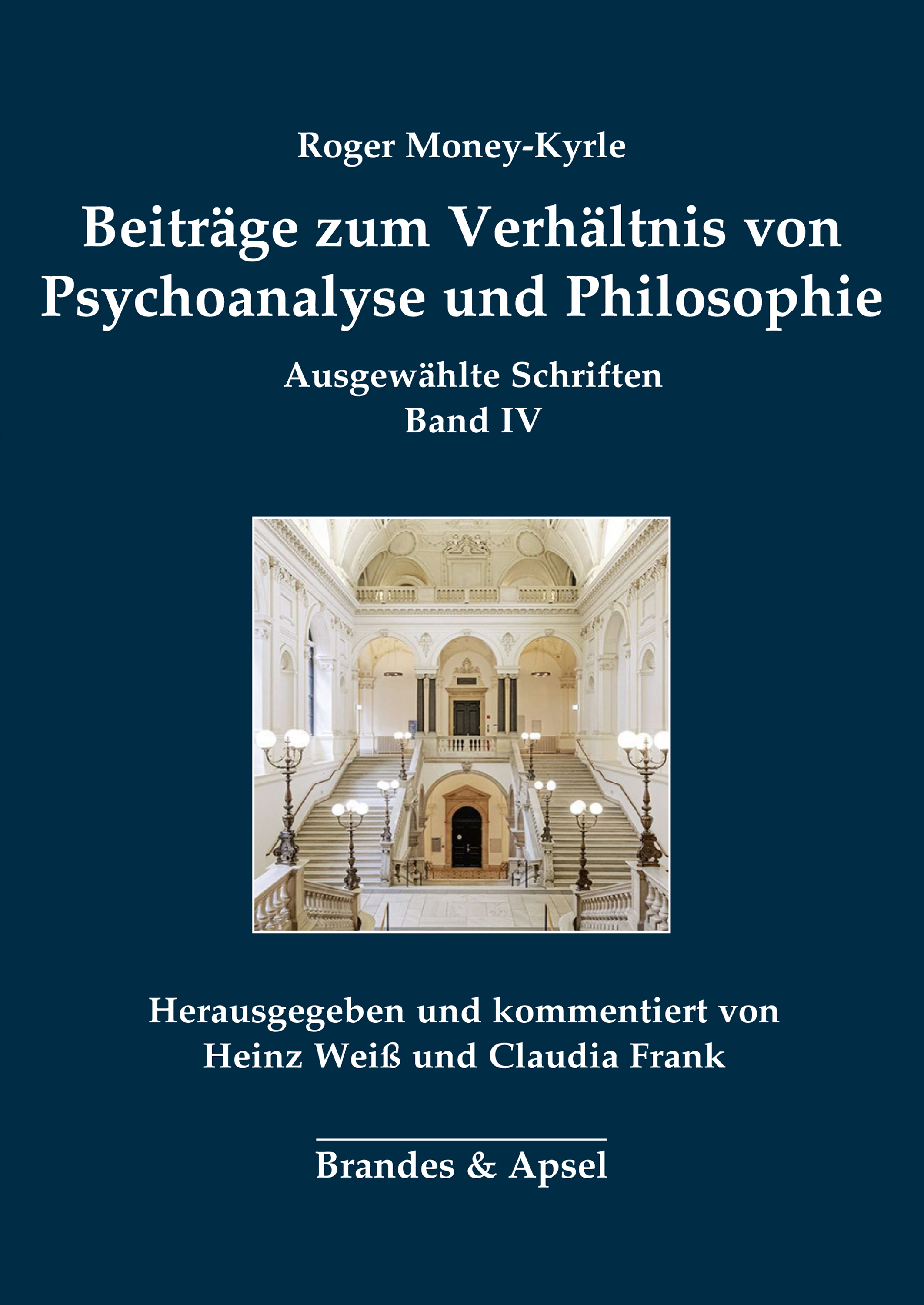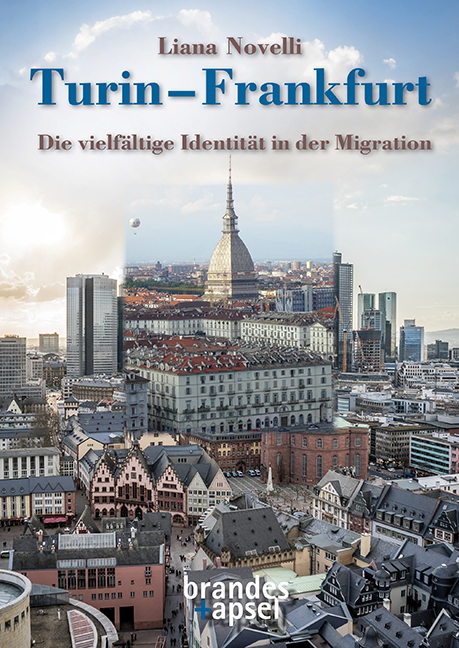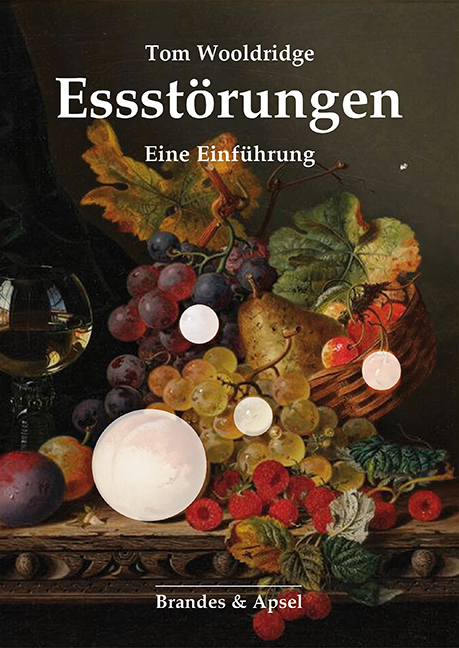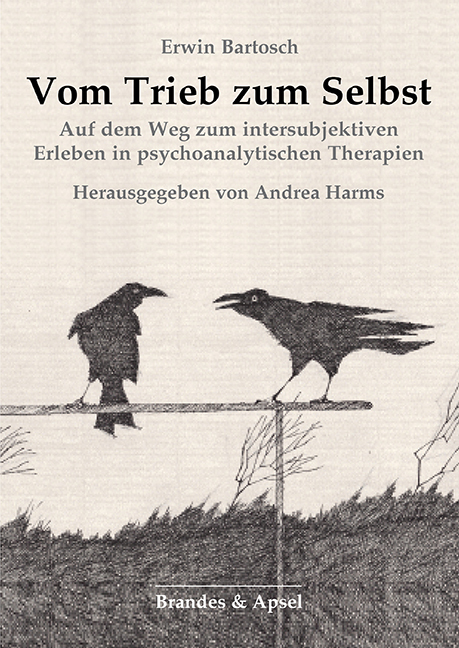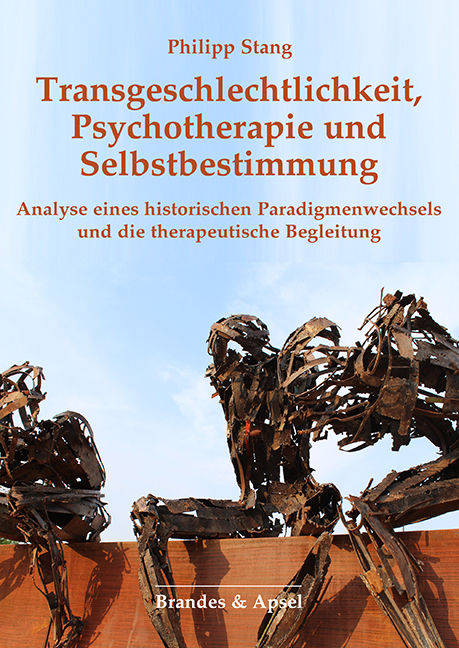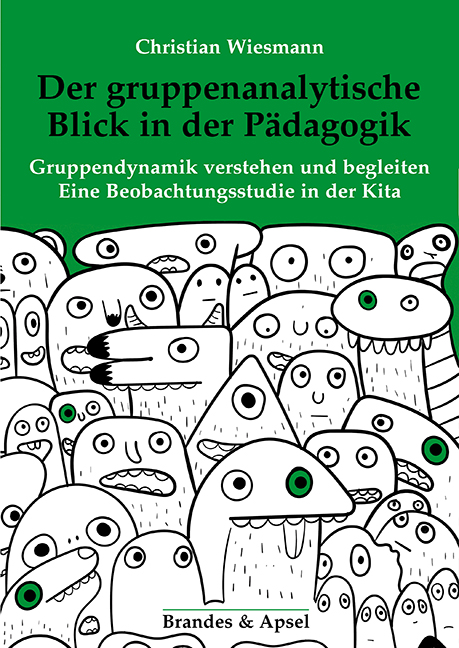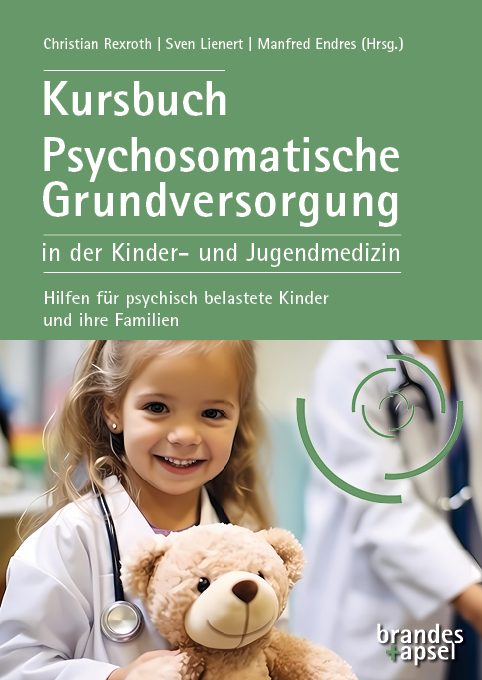Psychoanalyse und Film
Dieter Bürgin / Barbara Steck
Täter und Opfer, Macht und Ohnmacht sowie verletzende Grausamkeiten und deren Erleiden und Ertragen manifestieren sich in allen Gesellschaften und in den unterschiedlichsten Intensitäten. Im Verlauf der Entwicklung vom Kleinkind bis zum Erwachsenen gilt es, Formen zu finden, wie diese Interaktionsarten transformiert, also in gesellschaftlich tolerable Verhaltensweisen umgeformt werden können. Charlie Chaplins frühe Stummfilme entstanden im Umfeld des Ersten Weltkriegs. Sie sind voller grober sadistischer und masochistischer Handlungen, die in einer Zeit voller Gewalt begeisterten, denn die Menschen konnten sie schuldfrei und den Widerwärtigkeiten trotzend anschauen und befreiend lachen. Im Verlaufe seines Lebens gelang es Chaplin dann mittels Humor und Kreativität, die alten sadomasochistischen Impulse in poetische und warmherzige Filme in Auseinandersetzung mit den grundsätzlichen Themen seiner Epoche aufzunehmen. Das Buch geht den Schritten seiner enormen Reifung und dabei der Tragik und dem Glück in seinem Leben nach. Bürgin und Steck stellen dazu Überlegungen an, welche seelischen unbewussten Prozesse bei Chaplin zum Tragen gekommen sein mögen, um die Transformation schwerer früher Traumatisierungen in ein die Zeiten überdauerndes künstlerisches Werk möglich zu machen. Somit ist Chaplin ein durchaus für die Gegenwart wiederzuentdeckendes Vorbild!
Suizidalität
Franz Timmermann
Franz Timmermann legt ein Werk vor, das seine jahrzehntelange Forschung zusammenfasst und auf unkonventionelle Weise einen fundierten Blick auf adoleszente existenzielle Problemlagen wirft, vor denen sich selbst Psychotherapeut*innen oft unbewusst verschließen. Unterschieden wird grundlegend zwischen Suizidalität als lebenserhaltendem Prozess unter Einbezug des Todes und Suizidgefährdung als Begrenzung des Lebens. Suizidale Adoleszente haben verwickelte Hindernisse in ihrer Identitätsbildung zu bewältigen. Die Verzweiflung kann aber den Anstoß dazu geben, sich von Hindernissen auf dem Lebensweg zu befreien und eine konstruktive Identitätssuche zu beginnen. Ein Freiheitskampf ist notwendig, um Suizidalität zu einer lebensbejahenden Revolution werden zu lassen. Zum Vergleich dazu werden öffentlich gewordene Fälle skizziert, die diesen Kampf nicht aufnehmen und uns somit auch an die Grenzen unserer Berufskultur in der Psychoanalyse des Jugendalters führen.
Selbstpsychologie
Andrea Harms / Thomas Prior (Hrsg.)
Herausforderungen im psychoanalytisch selbstpsychologischen Prozess
Jahrbuch Selbstpsychologie, Band 6
Dieses Jahrbuch geht von der Grundannahme aus, dass menschliche Entwicklung auf intakte Resonanzräume angewiesen ist, also auf lebendige, emotionale Verbindungen zu anderen. Doch Kriege und Krisen, autoritäre Herrscher und (a)soziale Medien bedrohen diese Achsen der Mitmenschlichkeit und führen zu Rückzug, Einsamkeit, innerer Erstarrung. Häufig – vielleicht sogar immer häufiger – haben wir es im psychoanalytischen Prozess mit einer eingeschränkten Resonanzfähigkeit zu tun, die sich etwa in gehemmter Vitalität oder verlorener Selbstwirksamkeit äußert. Der Ansatz der Selbstpsychologie, weiterentwickelt durch intersubjektive und relationale Konzepte, eröffnet hier ein kontextorientiertes therapeutisches Verstehen und Arbeiten. Der Fokus liegt dabei sowohl auf »der inneren Erlebniswelt des Individuums als auch auf deren Eingebettetsein in andere derartige Welten und die kontinuierliche Beeinflussung, die zwischen ihnen besteht« (Stolorow & Atwood). Die Beiträge in diesem Buch beleuchten aus unterschiedlichen Blickwinkeln, was dies konkret für Theorie und Praxis bedeutet.
Narzissmus und Technologie
Carola Hesse-Marx
Kann mir bitte mal einer erklären, was Fortschritt ist!
Wider Technologiewahn und destruktiven Narzissmus
Wenn wir in unserer Menschheitsgeschichte zurückblicken, sehen wir einerseits Neid, Hass, Zerstörung. Dem stehen die großartigsten Zeugnisse der Kreativität und Liebesfähigkeit gegenüber. Immer versuchte der Mensch, dem Tod das Leben entgegenzusetzen. Das hat sich radikal geändert: Nun setzt der postmoderne Mensch dem Leben den Tod entgegen. Dass sich der Mensch mit seinem Werkzeug identifiziert, hat es niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte gegeben. Das ist wirklich neu. Es ist das Unheimlichste, das dem Menschen auf seiner langen evolutiven Suche nach sich selbst bisher eingefallen ist. Warum konstruieren Menschen Maschinen, die wie Menschen aussehen, technisierte Puppen, sogenannte »Humanoide Roboter« und sogenannte »Androide«, und technisierte Bilder, sogenannte »Avatare«, und behaupten, diese seien in nächster Zukunft der bessere Mensch? Warum löscht der postmoderne Mensch seine Natur, die das Leben ist, aus und ersetzt Leben durch – biologisch, psychisch und geistig – Totes? Die Psychoanalytikerin Carola Hesse-Marx geht der Frage nach, wie es dazu kommen konnte, dass sich Menschen anstatt mit dem Leben, mit lebloser Materie identifizieren. Und sie geht der Frage nach, warum das technisch konstruierte Wahngebilde destruktiver Narzissten gesellschaftlich als Fortschritt anerkannt wird.
Kinder- und Jugendlichen-Psychoanalyse
Peter Bründl / Sebastian Kudritzki / Catharina Salamander / Karin Trübel (Hrsg.)
Wege zur inneren Landschaft von Kindern und Jugendlichen
Jahrbuch der Kinder- und Jugendlichen-Psychoanalyse, Band 14
Die Autorinnen und Autoren unterschiedlicher analytischer Schulen aus der Schweiz, Deutschland, Portugal, Israel, England und den USA setzen sich mit ihren klinischen Theorien und mit ihren Behandlungsprozessen auseinander, die es ihnen ermöglichen, den entwicklungsförderlichen Zugang zur unbewussten Innenwelt und zu den Übertragungsphänomenen von Kindern und Jugendlichen zu finden. Im Mittelpunkt der Beiträge steht die gemeinsame, fortführende Arbeit des therapeutischen Paares.
Psychotherapeutisches Spielen
Dagmar Lehmhaus / Bertke Reiffen-Züger (Hrsg.)
Psychotherapeutisches Spielen mit dem Plämokasten
Psychodynamische Therapie mit Kleinkindern, Latenzkindern und Jugendlichen
Zur Verbesserung der Kompetenz von psychodynamischen Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutinnen und -Psychotherapeuten, um sich sicher im Bereich des kindlichen Spielens zu bewegen, wird ein Konzept zur professionellen Spiel-Selbsterfahrung mit dem Plämokasten mit Playmobil-Figuren vorgestellt. Dabei werden konkrete Spielszenen in ihrer therapeutischen Relevanz einbezogen. Nach der Reflexion, wie sich Spielfähigkeit und Spielen in der Kindheit entwickeln, wird das psychodynamisch-psychotherapeutische Spiel mit Miniaturfiguren – insbesondere mit Playmobil-Figuren des Plämokastens – fokussiert und in seiner historischen Entwicklung sowohl in Bezug auf die sozialen, technischen wie materiellen Implikationen dargestellt. Auf konkrete Handlungsanweisungen für den Umgang mit dem Plämokasten, Hinweise für die Auswertung von Spielszenen sowie eine Sammlung von Falldarstellungen folgt ein Kapitel mit den Ergebnissen einer wissenschaftlichen Untersuchung des Plämokastens. Außerdem werden weitergehende Anwendungsmöglichkeiten des Plämokastens im Bereich der Elternarbeit und der Erstellung von Gerichtsgutachten erörtert.
Psychoanalyse und Intersubjektivität
Wolfgang Kämmerer / Wolfgang Milch
Chaos und Poesie der Begegnung
Intersubjektive Verwicklungen in der psychodynamischen Psychotherapie
Im Zentrum des Buches stehen vier therapeutische Begegnungen und die Dynamik unbewusster Verwicklungen und die kreativen Antworten, die im gemeinsamen Prozess gefunden werden. Der lebendige Moment der Begegnung lässt sich nicht auf Theorien und technische Richtlinien reduzieren. Er enthält chaotische Elemente, die den Prozess prägen. Chaos zeigt sich im Ungeordneten der Begegnung, des Leids und in den kreativen Sprüngen des Prozesses. Poesie ist eine Weise, das Chaos zu ordnen. Die Begegnung ruft affektive, körperliche und kognitive Antworten hervor. Die Beteiligten öffnen sich diesem Austausch in besonderer Weise, dafür können die Metaphern des Tanzes oder des gemeinsamen Improvisierens eines Musikstückes passen, in dem von dem einen Schwingungen ausgehen und die den anderen ins Schwingen bringen und wieder neue Resonanzen auslösen. Klänge, Rhythmen, Harmonien oder Disharmonien werden als angenehm, wohltuend, störend oder auch quälend erlebt. Schrille und zu laut empfundene Töne und Geräusche bedrohen und lösen Abwehr aus. Findet ein Gespräch hingegen zu seinem Klang, Rhythmus und zur Modulation der Melodie, wird der Prozess von beiden gemeinsam getragen.
Psychoanalyse und Intersektionalität
Susanne Schade
Revolution in der Psychoanalyse?
Wie kann die Psychoanalyse revolutioniert werden, wenn dabei eine andere Variante von Psychoanalyse herauskommt? Die Revolution beginnt in der praktischen Arbeit mit Patient*innen aus sehr verschiedenen Kulturen und den daraus abgeleiteten theoretischen Überlegungen. Sehr wohl knüpft Susanne Schade an verschiedene Strömungen der politischen Psychoanalyse an, die durch die Emigration vieler jüdischer Psychoanalytiker*innen verdrängt worden waren, und gleichzeitig entstehen vielfältige Bezüge zu den Gender Studies oder den Cultural Studies. Nur durch eine intersektionale Perspektive und die Berücksichtigung multipler Formen von Diskriminierung beispielsweise hinsichtlich Race, Gender, Kultur oder Religion können wir uns ein Bild machen von den Symptomen der Menschen und ihrer Heilung.
Psychoanalyse und Philosophie
Roger Money-Kyrle
Beiträge zum Verhältnis von Psychoanalyse und Philosophie
Ausgewählte Schriften. Band IV
Das Verhältnis von Psychoanalyse und Philosophie hat Roger Money-Kyrle über sein gesamtes Werk hinweg beschäftigt. Wie kein anderer Schüler Kleins hat er sich systematisch mit den Beziehungen zu den Nachbarwissenschaften auseinandergesetzt. Der vorliegende Band beinhaltet grundlegende Texte zur Wirklichkeitslehre, zu Ethik, Anthropologie und Politik.
Migration
Liana Novelli
Die vielfältige Identität in der Migration
Migration wurde in den letzten Jahrzehnten stets kontrovers in der Öffentlichkeit diskutiert. Doch es gibt eine Kultur der Aufnahme von fremden Menschen, eine Neugier und eine Unterstützung ihres Ankommens und ihrer Integration. Davon erzählt Liana Novelli, die sich als Sprachlehrerin engagiert für den muttersprachlichen Unterricht an den Schulen, für eine Anerkennung durch die Mehrheitskultur, für die Rechte der migrantischen Frauen. Die Autorin sagt selbst: »Das Schreiben dieser Memoiren ist für mich wichtiger geworden als alles andere. Ursprünglich glaubte ich, es tun zu müssen, weil mich die Lektüre von Natalia Ginzburg dazu geführt hatte, aus der Pflicht heraus, ›eine Spur zu hinterlassen‹, für jemanden, der wie ich nicht glaubt, dass er weiterleben kann, außer in der Erinnerung, die andere an seine Erfahrungen haben könnten. Ich habe sie zu verschiedenen Zeiten verfasst, manchmal in Abständen von mehreren Jahren. Ich habe nichts verändert, um die Stimmungen, Gefühle und Befindlichkeiten zu bewahren, unter denen sie geschrieben wurden und die sich im Laufe der Zeit verständlicherweise verändert haben. Meine Absicht ist es, meinen Weg darzustellen, immer auf der Suche nach dem Ausdruck dessen, was ich nach und nach als mein Tun und das Wesen meiner Identität betrachtete.«
Essstörungen
Tom Wooldridge
Dieses Buch versteht sich als leicht zugängliche Einführung in die Behandlung von Essstörungen aus psychoanalytischer Perspektive. Jedes Kapitel beleuchtet einen anderen Aspekt der schwierig zu behandelnden Erkrankung und zeigt sowohl erfahrenen Klinikern wie Neueinsteigern die breite Perspektive des psychoanalytischen Behandlungsansatzes. Unterschiedliche Facetten der psychoanalytischen Theorie und Praxis werden aufgezeigt, welche die Betroffenen im Prozess, ihre Gefühle zu besser zu verbalisieren, ihr Verhältnis zu ihrem Körper zu erleichtern und die Disharmonien zwischen Körper und Seele in Einklang zu bringen unterstützen können. Auch der Umgang mit der Online-Welt (und besonders von einschlägigen Foren) wird behandelt.
Psychoanalyse und Selbstpsychologie
Erwin Bartosch
Auf dem Weg zum intersubjektiven Erleben in psychoanalytischen Therapien
Erwin Bartosch hat bereits 1976 (mit 31 Jahren) zu publizieren begonnen, damals noch als aktives Mitglied und später als Lehranalytiker des Wiener Arbeitskreises für Tiefenpsychologie. Nachdem er bereits 1974 den Schriften Heinz Kohuts begegnet war und dafür bei seinen damaligen KollegInnen kein Gehör fand, gründete er 1987 den »Wiener Kreis für Psychoanalyse und Selbstpsychologie« (WKPS), den er bis 2006 persönlich geleitet hat. 1999 etablierte er den Verlag »Neue Psychoanalyse Wien«. Die frühe Überzeugung, mit der Selbstpsychologie auf dem richtigen Weg zu sein, hat ihn nie verlassen und gab ihm die Klarheit, Kraft und Ausdauer, »seinen« Wiener Kreis zu gründen und auch über seine Publikationen den Weg für eine Zukunft grundzulegen.
Transgeschlechtlichkeit
Philipp Stang
Transgeschlechtlichkeit, Psychotherapie und Selbstbestimmung
Analyse eines historischen Paradigmenwechsels und die therapeutische Begleitung
Wie kann eine psychotherapeutische Begleitung transgeschlechtlicher Menschen heute aussehen – jenseits veralteter Krankheitsbegriffe und hin zu einer affirmativen, würdevollen Unterstützung? Diese fundierte, literaturbasierte Analyse beleuchtet die Entwicklung psychologischer und psychotherapeutischer Perspektiven auf Transidentität und Geschlechtsinkongruenz im Spannungsfeld zwischen medizinischer Diagnostik und gesellschaftlichem Wandel. Sie untersucht Lücken in der Forschung, kritisiert bestehende Ungleichheiten in der Versorgung und zeigt, wie sich das psychotherapeutische Handeln durch den Paradigmenwechsel hin zu einem entpathologisierten, normvarianten Verständnis von Geschlecht verändert. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Frage, wie Psychotherapeut:innen heute auf Basis aktueller Erkenntnisse, interdisziplinärer Empfehlungen und eigener professioneller Reflexion transgeschlechtliche Menschen wirksam und menschenwürdig begleiten können – auch in einem zunehmend nonbinären Geschlechtersystem. Ein wichtiges Fachbuch für alle, die sich mit Psychotherapie, Geschlechtsidentität und Menschenrechten beschäftigen – wissenschaftlich fundiert, kritisch reflektiert und hochaktuell.
Gruppenanalyse und Pädagogik
Christian Wiesmann
Der gruppenanalytische Blick in der Pädagogik
Gruppendynamik verstehen und begleiten. Eine Beobachtungsstudie in der Kita
Erzieher:innen, Lehrer:innen, Sozialarbeiter:innen, Therapeut:innen bewegen sich in ihrem Berufsalltag viel in Gruppen, Teams und sozialen Netzwerken. Gleichzeitig scheint die Eigenqualität von Gruppenprozessen in der theoretischen Konzeptentwicklung oft wenig berücksichtigt. Hilfreich ist hier die Gruppenanalyse nach S. H. Foulkes mit ihrer Netzwerktheorie, um Gruppendynamiken zu verstehen und zu begleiten. Deshalb wird auf der empirischen Grundlage von teilnehmenden Beobachtungen in einer Kita das spezifische Erkenntnispotenzial des gruppenanalytischen Blicks für das Denken und Handeln in der pädagogischen Praxis untersucht: In der gruppenanalytischen Untersuchung in einer Kita stellt sich heraus, wie gesellschaftliche Prozesse der Polarisierung und Ökonomisierung in pädagogische Institutionen und die psychische Entwicklung von Kindern hineinwirken und unbewusste Gruppendynamiken pädagogische Entwicklungsprozesse blockieren können. Die Gruppenanalyse bietet Pädagog:innen, Sozialarbeiter:innen, Therapeut:innen damit ein Reflexions- und Handlungsmodell, um ihre Adressat:innen wie auch sich selbst in der Dynamik sozialer Netzwerke und den emotionalen, konflikthaften, unbewussten Seiten mehr zu verstehen und so entwicklungsförderliche Interventionen abzuleiten. Die Gruppenanalyse liefert ein tiefenpsychologisch-verstehendes, gesellschaftskritisch-reflexives und emanzipatives Erkenntnispotenzial, das nicht zuletzt angesichts der aktuellen Brisanz gesellschaftlicher Spaltungsprozesse von hohem Wert ist. Das Buch führt in gruppenanalytisches Verstehen und Handeln ein und veranschaulicht dies praktisch am Beispiel einer Kitagruppe.
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Christian Rexroth / Sven Lienert / Manfred Endres (Hrsg.)
Kursbuch Psychosomatische Grundversorgung in der Kinder- und Jugendmedizin
Hilfen für psychisch belastete Kinder und ihre Familie
Psychosomatische Beschwerden wie erhöhte Irritabilität, Schlafprobleme, Bauch- und Kopfschmerzen, Verstimmungszustände und eine beeinträchtigte Lebensqualität gehören zu den häufigsten Beschwerden von Kindern und Jugendlichen. Daher hat der 127. Deutsche Ärztetag 2023 die Psychosomatische Grundversorgung als festen Bestandteil der Facharztweiterbildung auf dem Gebiet Kinder- und Jugendmedizin in die (Muster-)Weiterbildungsordnung integriert. Auch die Ärztliche Akademie für Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen e. V., ein bundesweit anerkanntes Fort- und Weiterbildungsinstitut, hat sich dafür ausgesprochen. Der als gemeinnützig anerkannte Verein widmet sich der seelischen Gesundheit von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien. Seit fast 50 Jahren bietet die Ärztliche Akademie überregional Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen an, darunter seit 15 Jahren auch eine Fortbildung in Psychosomatischer Grundversorgung, an der bislang über 600 Ärztinnen und Ärzte teilgenommen haben. Die von den Landesärztekammern anerkannte Fortbildung hilft, den Blick für seelische und psychosoziale Ursachen von psychosomatischen Krankheitsbildern zu schärfen und die seelische Versorgung von Kindern und Jugendlichen flächendeckend zu verbessern. Mit dem Kursbuch stellen wir ein Standardwerk vor, das für unterschiedlichste Problemstellungen nicht nur in der kinderärztlichen Praxis als kompaktes Nachschlagewerk dienen kann.
Klinische und interdisziplinäre Psychoanalyse
Christine Bauriedl-Schmidt, Markus Fellner, Sebastian Kudritzki (Hrsg.)
Phantasie, Abwehr und Realitätsbewältigung: Was ist noch echt, bedeutungsvoll und real?
Jahrbuch für klinische und interdisziplinäre Psychoanalyse, Band 3
Der dritte Band des »Jahrbuch für klinische und interdisziplinäre Psychoanalyse« nähert sich unter dem Titel Kunst und Künstlichkeit zwei Begrifflichkeiten, die je Kulturleistungen des Menschen bezeichnen und damit auf Verzicht, Aneignung, Anerkennung sowie Beherrschung, Gestaltung und Symbolisierung von Natur, Natürlichem und materiell Gesellschaftlichem setzen. Das Konzept Künstlichkeit erfährt nun insbesondere durch den Diskurs um die Künstliche Intelligenz (KI) einen immensen und neuen Auftrieb. Ihr wird eine unglaubliche schöpferische Wirkmächtigkeit zugeschrieben, die in Teilen schon heute unsere Realität prägt. Wir können sie als eine Künstlichkeit verstehen, die sich gewissermaßen unabhängig entwickelt und etwas Eigenes hervorbringt, von dem wir nicht wissen, was es eigentlich ist. Was ist überhaupt Künstlichkeit? Kann sich daraus eigenes Leben entwickeln? Kommt ihr eine Form von Bewusstsein zu? Wie können wir mit Künstlicher Intelligenz in Verbindung treten und was bedeutet das für uns als Subjekte?
Transgenerativität
Jill Salberg / Sue Grand
Jill Salberg und Sue Grand bieten einen Überblick über die psychoanalytische Arbeit zu transgenerationalen Traumata, wobei sie ihre Perspektive in der Bindungstheorie und der sozialethischen Wende der relationalen Psychoanalyse verankern. Transgenerationales Trauma ist eine bahnbrechende Studie über die Übertragung von Traumata über Generationen hinweg. Salberg und Grand untersuchen, wie das Trauma unserer Vorfahren eine Narbe in unserem Leben, unserem Körper und unserer Welt hinterlassen kann. Sie gehen davon aus, dass wir die soziale Gewalt, der wir ausgesetzt waren, allzu oft wiederholen. Ihr einzigartiger Ansatz umfasst bei der Beschäftigung mit Bindung, Hinterlassenschaften von Gewalt und der Rolle von Zeugenschaft bei der Heilung verschiedene psychoanalytische und psychodynamische Theorien. Klinische und persönliche Geschichten werden mit der Theorie verwoben, um die sozio-historischen Positionen zu verdeutlichen, die wir erben und ausleben.
Männlichkeit
Sebastian Leikert
Der desorientierte Mann – Hindernisse auf dem Weg zu einer generativen Männlichkeit
Warum fällt es Männern in Beziehungen so schwer, die Herausforderungen, die die Frauenemanzipation seit über 50 Jahren mit sich bringt, positiv anzunehmen? Sebastian Leikert untersucht die individuell-unbewussten und allgemein-gesellschaftlichen Hindernisse, die Männer davon abhalten, im Parlament der Beziehungen kooperativ zu verhandeln. Leikert zeigt Wege auf, die es ermöglichen, Paarbeziehungen mit Spaß und Erfolg konstruktiv zu verändern, sodass sie von mehr Leichtigkeit geprägt sind und nicht aufhören, spannend zu sein.
Weitere Titel zum Thema Männlichkeit
Psychodynamik des Down-Syndroms
Karin J. Lebersorger (Hrsg.)
Menschen mit Down-Syndrom verstehen
Psychodynamisch orientierte Prävention, Beratung und Behandlung
Karin J. Lebersorgers Arbeit mit Menschen mit Down-Syndrom ist vom Bemühen geleitet, ihre seelischen Nöte zu verstehen und eine psychisch unbelastete Entwicklung zu unterstützen. In ihrem zweiten Buch widmet sie sich den Verhaltensweisen und Symptomen, mit denen sie in den letzten 18 Jahren in der Down-Syndrom Ambulanz Wien befasst war. Sie beschreibt die Auswirkungen frühester Erlebnisse, unbewusster Konflikte und vermiedener Auseinandersetzung mit dem Down-Syndrom auf die Befindlichkeit und das Verhalten. Ein besonderes Anliegen ist ihr in der Beratung gemeinsam mit den Eltern ein Verständnis für die zugrunde liegende innerpsychische und familiäre Dynamik zu entwickeln. Das Buch richtet sich an alle Fachpersonen, die in unterschiedlichen Kontexten mit Menschen mit Down-Syndrom arbeiten, sowie an interessierte Eltern und Bezugspersonen.
Weitere Bücher von Karin J. Lebersorge finden Sie hier.
Klimapolitik
Tamra Gilbertson / Oscar Reyes
Wie Luftverschmutzer belohnt werden. Analyse, Kritik, Perspektiven
Der Emissionshandel gilt als viel versprechendes Instrument zum Schutz des Klimas. Die beteiligten Akteure – Staaten und Unternehmen – verpflichten sich im Rahmen eines Abkommens dazu, den Ausstoß von Treibhausgasen auf ein festgelegtes Maß zu reduzieren. Wem das gelingt, der verfügt über »Emissions-Guthaben«, die an einer Tauschbörse verkauft werden können. So hielten beide, die Viel- und Wenigverschmutzer, die Vorgaben beim Klimaschutz ein. Nein, sagen die Autoren, der Handel mit Emissionszertifikaten bringt den Klimaschutz entgegen solcher Behauptung nicht voran, sondern wird selbst zum Geschäft. Ihre Analyse begründet anhand von Fallstudien, warum der globale Emissionsmarkt ein Irrweg ist. Arme Länder profitieren kaum davon. Die Gewinner sind die Industriestaaten und große Konzerne, die auch künftig auf fossile Brennstoffe setzen und Geschäfte damit machen.